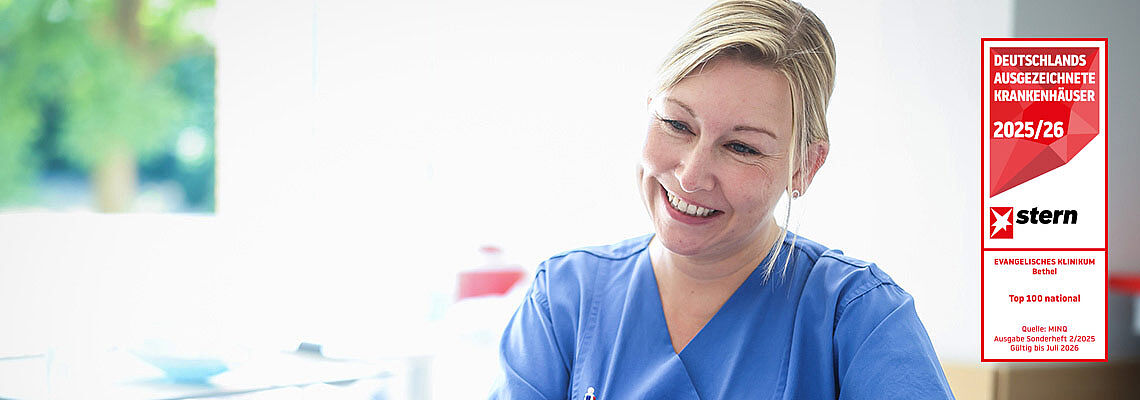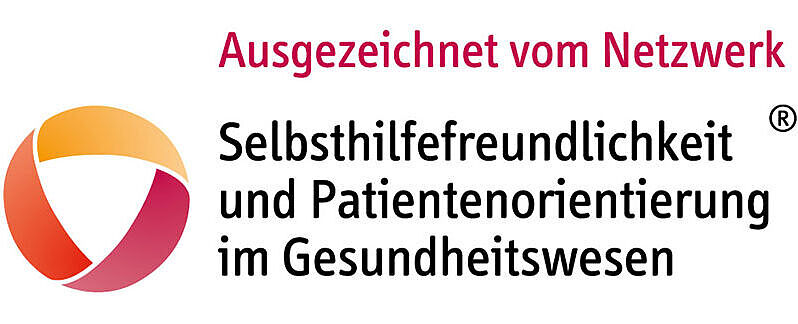- Startseite >
- Presse & Termine >
- Dreiländerkongress in Bethel: Internationale Bühne für die psychiatrische Pflege
Dreiländerkongress in Bethel: Internationale Bühne für die psychiatrische Pflege
Eine Psychiatrie ohne Zwangsmaßnahmen? Florian Wostry glaubt daran, auch wenn es noch ein weiter Weg zum Ziel sei. „Die therapeutische Beziehung ist unser wichtigstes Werkzeug – und durch die Anwendung von Zwangsmaßnahmen zerbricht sie“, so der Doktorand der Pflegewissenschaften an der Universität Wien. Er war einer der Eröffnungsredner beim Dreiländerkongress „Pflege in der Psychiatrie“ Mitte September in Bielefeld-Bethel. Mehr als 400 Expertinnen und Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz besuchten die insgesamt 18. Ausgabe der Fachtagung, die sich in diesem Jahr mit den Schwerpunktthemen „Verletzung“ und „Verletzlichkeit“ auseinandersetzte.


Florian Wostry sprach zum Thema Zwangsmaßnahmen in der psychiatrischen Pflege. Fotos: Sarah Jonek
„Die Psychiatrie steht vor einem Paradigmenwechsel“, sagt Florian Wostry. Denn sowohl die Vereinten Nationen als auch die Weltgesundheitsorganisation WHO strebten eine Gesetzgebung an, die in der Psychiatrie keine Zwangsmaßnahmen mehr zulasse. „Solange dieser Wechsel noch nicht stattgefunden hat, befinden wir uns in einem ethischen Dilemma. Unsere berufliche Profession hat das Ziel, die Gesundheit der Patientinnen und Patienten zu fördern und eine bestmögliche psychiatrische Pflege zu leisten.“ Trotzdem sehe der praktische Alltag in der psychiatrischen Pflege noch immer vor, Personen mit selbst- oder fremdgefährdendem Verhalten mechanisch zu fixieren oder zu isolieren.
Das Plädoyer von Florian Wostry an das Publikum: die eigene Verletzlichkeit zulassen – und dadurch eine bessere psychiatrische Pflege ermöglichen. Denn nicht nur Patientinnen und Patienten seien physisch und psychisch verletzbar, sondern auch Pflegekräfte. „Wer sich seiner eigenen Verletzlichkeit bewusst ist, hat die Fähigkeit, Empathie zu zeigen. So kann ich mich ungefähr in die Position des Patienten oder der Patientin hineinversetzen – und so entsteht die therapeutische Beziehung, die maßgeblich für den Behandlungserfolg verantwortlich ist.“ Sonst bestehe die Gefahr einer Dehumanisierung, so der ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger. Nachbesprechungen sowohl im Team als auch mit den Betroffenen seien ein äußerst wichtiges Mittel, um belastende Situationen zu evaluieren.
Über eine schwierige Situation, in der sich Angehörige von psychisch erkrankten Menschen befinden, berichtete Dr. Christiane Erbel, Erste Vorsitzende des Vereins arwed. Der Verein setzt sich für die Interessen, Bedürfnisse und Forderungen von Eltern drogenabhängiger Kinder und Jugendlicher ein. „Eltern, Pflegende und Schulen werden mit diesem Thema weitestgehend alleingelassen“, so die Einschätzung der Psychologin und selbst betroffenen Mutter.


Den Dreiländerkongress eröffneten (v. l.) Prof. Dr. Sabine Hahn, Leiterin des wissenschaftlichen Beirats des Dreiländerkongresses, Dorothea Sauter, Präsidentin Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege, Jacqueline Rixe, Mitglied des Organisationsteams und Pflegewissenschaftlerin an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Evangelischen Klinikums Bethel (EvKB), Petra Krause, Pflegedirektorin des EvKB und Mitglied der Pflegekammer NRW, Sandra Postel, Präsidentin der Pflegekammer in NRW und Prof. Dr. Michael Schulz, Stabsgruppe für Klinikentwicklung und Forschung am LWL-Klinikum Gütersloh und Mitglied des Organisationsteams. Fotos: Sarah Jonek
Nach wie vor sei Sucht eine besonders stigmatisierende Erkrankung. Schuld- und Schamgefühle seien nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für Angehörige eine besondere Belastung. Auch das sei eine Form der Verletzung, so Dr. Christina Erbel. Sie kritisiert, dass Eltern zu oft für die Suchterkrankung ihrer Kinder verantwortlich gemacht würden. Die vorherrschende Wahrnehmung sei: „Wenn ein Kind drogensüchtig wird, dann muss daran auch jemand schuld sein.“ Unterstützungsangebote für betroffene Eltern gebe es kaum, deshalb sei der Verein arwed bereits vor 30 Jahren gegründet worden, um betroffene Eltern und Selbsthilfegruppen besser zu vernetzen.
Allgemeine Nachrichten
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie